
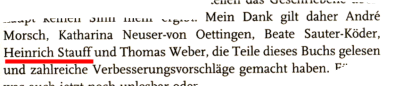
Populärwissenschaft
 | 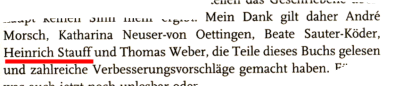 |
zu einem konkreten Beispiel siehe auch ![]()
"Wissenschaft kann nie im eigentlichen Sinne populär werden."
(Max Planck)"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher."
(Albert Einstein)
"Ich
habe ihn [den "Brief über die Sonnenflecken"] in der Volkssprache
[statt in der Wissenschaftssprache Latein] geschrieben, weil ich es als
notwendig ansehe, dass jedermann ihn lesen kann. [...] aus dem Grunde
nämlich, dass ich sehe, wie die jungen Männer sich gleichgültig den
Studien verschreiben, um Ärzte, Philosophen etc. zu werden, und wie
viele sich diesen Berufen widmen, auch wenn sie dazu durchaus
ungeeignet sind, während andere, die geeignet wären, von häuslichen
Pflichten oder Tätigkeiten in Anspruch genommen werden, die der
Wissenschaft fern sind."
(Galileo Galilei)
"[...] es gibt eine Neigung zu
vergessen, dass die gesamte Wissenschaft an die menschliche Kultur
überhaupt gebunden ist und dass wissenschaftliche Entdeckungen, mögen
sie im Augenblick auch überaus fortschrittlich und geistreich und
unfasslich erscheinen, außerhalb ihres kulturellen Rahmens sinnlos sind.
Eine theoretische Wissenschaft, die sich nicht dessen bewusst ist, dass
die Begriffe, die sie für relevant und wichtig hält, letztlich dazu
bestimmt sind, in Begriffe und Worte gefasst zu werden, die für die
Gebildeten verständlich sind, und zu einem Bestandteil des allgemeinen
Weltbildes zu werden - eine theoretische Wissenschaft, sage ich, in der
dies vergessen wird und in der die Eingeweihten fortfahren, einander
Ausdrücke zuzuraunen, die bestenfalls von einer kleinen Gruppe von
Partnern verstanden werden, wird zwangsläufig von der übrigen
Kulturgemeinschaft abgeschnitten sein; auf lange Sicht wird sie
verkümmern und erstarren, so lebhaft das esoterische Geschwätz
innerhalb ihrer fröhlich isolierten Expertenzirkel auch weitergehen
mag."
(Erwin Schrödinger, Nobelpreisträger für Physik; für diese
Äußerung ist er von Stumpfwissenschaftlern in der Luft zerrissen
worden)
"Wenn man ein Ergebnis nicht in
einfachen, nichtwissenschaftlichen Worten erklären kann, hat man es
nicht verstanden."
(Ernest Rutherford, Nobelpreisträger für Physik)
"Ein Mathematiker hat erst dann sein eigenes Werk gründlich verstanden und klar genug erfasst, wenn er es [oder zumindest seine Grundzüge] dem nächstbesten Menschen auf der Straße einwandfrei erklären kann."
(Joseph Louis Lagrange)"Mein sehr verehrter Herr,
es gibt da eine Sache, die ich Sie gerne fragen möchte. Wenn sich ein Mathematiker mit der Erforschung physikalischer Vorgänge beschäftigt und aufgrund der Ergebnisse zu seinen eigenen Schlüssen gelangt, sollten diese dann nicht in allgemeinverständlicher Sprache ausgedrückt werden, ebenso vollständig, klar und eindeutig wie in mathematischen Formeln? Wenn ja, wäre das nicht für uns alle ein großer Segen, sie auf diese Art auszudrücken - sie aus ihren Hieroglyphen zu übersetzen, so dass wir auf ihrer Grundlage mit Experimenten arbeiten können? Ich denke, so muss es sein, denn ich war immer der Ansicht, dass Sie mir eine vollkommen klare Vorstellung von Ihren Folgerungen vermitteln können, die - obwohl sie mir kein vollständiges Bild von den einzelnen Schritten Ihres Vorgehens geben - die Ergebnisse weder unterhalb noch oberhalb der Wahrheit und ihrem Wesen nach so klar verdeutlichen, dass ich auf ihrer Grundlage denken und arbeiten kann.
Sollte dies möglich sein, wäre es dann nicht eine gute Sache, wenn Mathematiker, die über diese Themen schreiben, uns ihre Resultate sowohl in dieser allgemeinverständlichen und nützlichen Form als auch in ihrer eigenen, für sie angemessenen Form geben würden?
Für immer, mein verehrter Herr, verbleibe ich hochachtungsvoll."
(Das eine Physik-Genie [Michael Faraday; mathematischer Legastheniker] an das andere [James Clerk Maxwell])"Wir betreiben die Wissenschaft nicht [nur?] für uns selbst, sondern [auch?], um sie anderen einfach zu erklären."
(Niels Bohr, Nobelpreisträger für Physik)
"Wie kommt es, dass Mathematik
ein so wunderschönes Gebiet ist, Studenten dies aber in vier Jahren auf
dem College nicht herausfinden, trotz vieler Mathematikstunden?"
(Frage eines anonymen Kollegen an Robert Ossermann)
"Meiner Ansicht nach hat das Bild vom wissenschaftlichen Genie mehr Schaden als Nutzen angerichtet, [...] weil [...] die Vorstellung, die Wissenschaft sei heldenhaften Entdeckungen einzelner Personen zu verdanken, einen katastrophalen Effekt auf die Kultivierung der Wissenschaft durch die Gesellschaft hatte."
(Simon Schaffer)"Vielleicht ist das Verfassen eines populären Buchs [für NaturwissenschaftlerInnen] der Schlüssel dafür, der Nachwelt in Erinnerung zu bleiben."
(Jack Repcheck)
Vorweg: Populärwissenschaft ist keineswegs nur für Laien nötig, sondern auch für FachwissenschaftlerInnen:
"In welcher Unterdisziplin würde dieses Buch verstanden werden? Wenn es sich primär an diejenigen wendete, die sich mit Molekularbiologie beschäftigen, wären die Ideen dann denjenigen vertraut genug, die sich mit Naturgeschichte befassen? Wendete es sich strikt an Evolutionsbiologen, würden unsere Thesen die meisten Molekularbiologen vor den Kopf stoßen, die die Fragen sonderbar und die Beispiele exotisch fänden. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ein allgemein verständliches, direktes Vokabular wesentlich ist, um Wissenschaftler als Gruppe zu erreichen. Um über den Kreis der Wissenschaftler hinauszugehen und ein Laienpublikum anzusprechen, waren weitere Anpassungen erforderlich, wenn auch weniger, als man erwarten würde."
(zitiert nach; rote Markierungen von mir, H.St.)
Vor der fachgerechten Popularisierung von Wissenschaft habe ich denselben Respekt wie vor den wissenschaftlichen Leistungen selbst, ja, manchmal noch größeren.
Noch größeren beispielsweise bei meinen beiden Fächern Mathematik und Deutsch, die sich (anders etwa als Geschichte und Naturwissenschaften) den Teufel um eine Popularisierung scheren, ja, sich meist aus universitärem Standesdenken und Dünkel zu schade bzw. zu feige sind, sich "die Finger schmutzig" zu machen (also ein Problem manchmal in halber Differenziertheit darzustellen zu müssen).
Natürlich muss es auch l´art pour l´art und zweckfreie Grundlagenforschung geben. Direkte Verwertbarkeit ist eine viel zu simple und kurzfristige Forderung, ja, Nicht-Verwertbarkeit ist geradezu ein notwendiger Aufstand gegen die Effizienz, geht es doch um "Erkenntnis um ihrer selbst willen" und um Spiel!
(So blöd bin ich – nebenbei – nicht zu verkennen, dass uns Grundlagenforschung manchmal in größte Probleme führt, weil [ganz nach Günther Anders in "Die Antiquiertheit des Menschen"], was möglich ist, grundsätzlich auch ausprobiert wird.)
Und natürlich ist auch nicht jeder komplexe Sachverhalt jedem Laien vermittelbar. Viele Wissenschaft bedarf nunmal eines soliden Vorwissens, und viele ist nunmal nur absoluten Spezialisten verständlich.
Natürlich darf nicht verschwiegen werden, dass vieles nunmal per se unanschaulich ist.
Und dennoch empfinde ich z.B. Graßmanns Statement als ermutigend, ja, geradezu als Aufforderung und Verpflichtung:
"Die Mathematik dient dem Physiker als Werkzeug, sie ist für ihn, was der Kran für den Arbeiter am Bau ist. Um einen Bau zu errichten, ist ein Kran notwendig, wenn man nachher das Bauwerk besehen oder gar bewohnen möchte, da stünde der Kran nur im Weg rum, und so schafft man ihn besser weg."
Wichtig daran scheint mir unbedingt: ohne Mathematik bzw. ohne den Kran geht es auch nicht, sie sind "notwendig".
Ein Beispiel: wenn ich Simon Singhs populärwissenschaftliches Buch
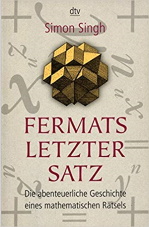 lese, erhalte ich einen weiträumigen Einblick in mathematische Denkweisen, auch wenn ich mir nicht einbilde, die komplizierte Mathematik dahinter (die Singh wohlweislich nur ansatzweise behandelt) zu verstehen.
lese, erhalte ich einen weiträumigen Einblick in mathematische Denkweisen, auch wenn ich mir nicht einbilde, die komplizierte Mathematik dahinter (die Singh wohlweislich nur ansatzweise behandelt) zu verstehen.
Der deutsche Papst der
Mathematikgeschichte, Herbert Meschkowski, hat hingegen das Buch
 geschrieben, das kaum
je Einblick in Zusammenhänge und typische, übergreifende Denkweisen
gibt, sondern das man auch wieder nur wie ein konventionelles
Mathe-Buch durchpauken muss. "verständlich" ist da nurmehr ein Euphemismus!
geschrieben, das kaum
je Einblick in Zusammenhänge und typische, übergreifende Denkweisen
gibt, sondern das man auch wieder nur wie ein konventionelles
Mathe-Buch durchpauken muss. "verständlich" ist da nurmehr ein Euphemismus!
Populärwissenschaft ist nicht bloß ein gönnerhaft-herablassend hingeworfener Brosamen für die "dummen" Laien, sondern
deren gutes Recht, ermöglichen sie mit ihrer Arbeit und der von ihnen erstellten Infrastruktur überhaupt erst Wissenschaft, und
ist das Beste, was Wissenschaft passieren kann, doch gerade weitestmögliche Verbreitung und Popularisierung.
Es gibt kein Exklusivrecht von Wissenschaftlern auf Wissenschaft. Wenn sie meinen, dieses Exklusivrecht zu haben, ist das nurmehr Arroganz.
Nun muß man natürlich ergänzen, daß
viele Wissenschaftler mit ihrer "Grundlagenforschung" schon derart beschäftigt sind, daß sie wahrhaft keine Zeit mehr für Populärwissenschaft haben,
das universitäre Ideal, die unio mystica von "Forschung und Lehre", nunmal oft nicht funktioniert: da ist jemand zwar ein großer Wissenschaftler, aber ihm fehlt jedes pädagogische Vermögen (dennoch sollte am Ideal festgehalten werden, weil nur so eine fähige nächste Generation heranwachsen kann).
Und doch ist es merkwürdig, dass ausgerechnet die größten Wissenschaftler – z.B. Einstein oder Heisenberg – durchaus Zeit für die populäre Verbreitung bzw. Darstellung ihrer Erkenntnisse fanden:
in höherem Alter, als ihr kreatives Potential nachließ und sie sich daher eher für den (ebenso wichtigen!) Überblick zuständig fühlten;
weil sie sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung und Abhängigkeit bewusst waren?
weil sie schon immer einfach denken konnten, ja, gerade mit den simplen Fragen überhaupt erst auf ihre großen Erkenntnisse gekommen waren.
Vielleicht hängen Populärwissenschaft und Wissenschaft also enger zusammen, als man auf Anhieb meinen sollte, vielleicht ist erstere nicht bloß (notfalls weglassbares) Abfallprodukt der letzteren, sondern deren insgeheime Voraussetzung.
Vielleicht hätten wir eine bessere Wissenschaft, wenn wir eine bessere Populärwissenschaft hätten. Eben weil dann junge Leute einen besseren, weniger abschreckenden, ermutigerenden Einstieg in die Wissenschaft und deren Grundfragen erhielten!
Ich habe mich ja schon immer darüber aufgeregt, daß zu Beginn meines Studiums weder in Germanistik noch in Mathematik eineR der DozentInnen bereit oder fähig war, mich (wie überhaupt Anfänger) bei meinem Vorwissen und meinen Voreinstellungen abzuholen.
Es mag an den neuen Klagen der Universitäten ja was dran sein, dass die Abiturienten immer weniger Grundlagen mitbrächten, auf denen die Universitäten direkt aufbauen könnten. Aber sind die Universitäten denn je auf den Gedanken gekommen, echte "Forschung und Lehre" für Anfänger zu betreiben, d.h. die Anfänger da (und seis beim typischen Hermann-Hesse-Identifikations-Komplex von Germanistik-Anfängern) abzuholen und von da aus weiter zu begleiten, wo immer sie nunmal gerade sind? (... was Anforderungen ja nicht ausschließt!)
Die meisten Dozenten (wie ja auch viele Lehrer) sind derart meilenweit vom Anfängerstatus entfernt, dass sie sich gar nicht mehr vorstellen können, daß sie selbst auch mal Anfänger waren. Oder sie (die Kleingeister unter den Wissenschaftlern) setzen einen einseitigen Fanatismus voraus, den sie selbst viel zu früh hatten.
Warum denn, zum Teufel, musste ich erst lange nach meinem Studium feststellen, dass man beispielsweise Linguistik und alle Mathematik auch populärwissenschaftlich, historisch und überhaupt (von der Sache aus, also ohne billige Gags und Anwendbarkeits-Anbiederung) interessant darstellen kann?
Warum wurde ich kleinschrittig durch Analysis I und II und Algebra I und II und Funktionentheorie I und II geprügelt (Vermutung, Beweis, Vermutung, Beweis, Vermutung, Beweis usw. bis zum Abwinken), ohne dass jemals jemand versucht hätte, mir Hintergründe und Zusammenhänge zu zeigen? Warum erhalte ich erst jetzt mit Simon Singhs Buch "Fermats letzter Satz" einen ebenso verständlichen wie spannenden Einblick in die Entwicklung und Zusammenhänge der (kompliziertesten, neuesten) Mathematik?
Da fühle ich mich noch nachträglich reingelegt und gedemütigt!
Nun, vielleicht liegt's einfach daran, dass Populärwissenschaft, gerade wenn sie einfach sein soll, schrecklich schwierig herzustellen ist und wir deshalb so lange auf Singh warten mussten.
Aber ich mache ja nicht nur der Universität Vorwürfe, sondern vermute Gründe auch bei mir selbst: vielleicht hätten mich die Zusammenhänge und Hintergründe damals auch gar nicht interessiert bzw. erreicht, weil die wissenschaftliche Welt noch nur in Scherben vor mir lag, die erst langsam zusammengesetzt werden mußten. Vielleicht kann einen aber auch die historische Perspektive überhaupt erst interessieren, wenn man sich selbst als historisches Wesen (mit eigener Geschichte und eingebunden in äußere Geschichte) erfahren hat. Also ab so ca. 30!
Ich weiß durchaus, wie schwierig eine Lösung des "Forschung-Lehre"-Problems wäre:
Einerseits könnte man natürlich eine Art Vorstudium und Baccalaureat wie etwa in England einführen, in dem weniger von Wissenschaftlern (Professoren) als von befähigten Vermittlern unterrichtet würde. Und viele Studenten würden dann nur dieses Baccalaureat machen, nur wenige auch das Aufbaustudium. Mit diesem Baccalaureat wären die Studenten allemal befähigt, in vielerlei Berufe zu gehen. In Deutschland sind die Berufskarrieren ja immer noch viel zu eng: weder die Studenten selbst noch die Betriebe sind bereit, Quereinstiege zu machen bzw. zu ermöglichen.
Andererseits habe ich durchaus meine Bedenken bei solch einem Baccalaureat: es war ja immer der große, geradezu vorbildliche Vorteil des deutschen Universitätssystems, dass die Studenten von Anfang an auch Kontakt zur vordersten Front der Forschung, also zu Professoren, hatten, und dass umgekehrt die Professoren die Lehre nicht auf eine Vermittler-Kaste abschieben konnten, also auch Kontakt zu den neuen Fragen der Jugend behielten. Und ebenso halte ich es durchaus für einen Vorteil, dass beispielsweise Lehrer nicht bloß ein Halb-, sondern ein fachwissenschaftliches Vollstudium bekommen. Nur so können sie an Gymnasien halbwegs (populärwissenschaftliche!) Wissenschaftspropädeutik betreiben.
(Nebenbei: bei aller vielleicht zu beklagenden Aufweichung des Abiturs ist es eben doch auch ein Fortschritt, daß heute immer mehr junge Menschen Abitur machen, also kurze Einsicht in wissenschaftliches Denken erhalten - selbst wenn sie hinterher nicht studieren.)
Wenn aber – wie oben gezeigt – viele Wissenschaftler einfach keine Zeit für Populärwissenschaften haben oder zu ihr unfähig sind, so bedarf die Wissenschaft eben dringend der Ergänzung durch Populärwissenschaft. Ja,
| ich könnte mir Populärwissenschaft tatsächlich als eigenen Studiengang (im engsten Kontakt mit den Einzelwissenschaften) vorstellen. |
Es ist auch eine Verachtung des Publikums, wenn man es für dumm verkauft und nur mit wissenschaftlichen Gags (tollen Effekten, aber keiner einzigen Erklärung)
abspeist, wie es etwa in der früheren unsäglichen ZDF-Sendung
 [Show!]
und heute genauso in
[Show!]
und heute genauso in  geschieht. Was da passiert, passt einerseits bestens in die derzeitige allgemeine Verflachung von Information (wie z.B. auch in "News-Shows") und ist andererseits geradezu obszön: Pseudo-Informations-Häppchen hinzuwerfen, um ausgerechnet damit von echter Information abzuhalten. Das ist, als würde man einem Hungernden Brot nur zeigen und ihm gezielt verschweigen,
dass es essbar ist.
geschieht. Was da passiert, passt einerseits bestens in die derzeitige allgemeine Verflachung von Information (wie z.B. auch in "News-Shows") und ist andererseits geradezu obszön: Pseudo-Informations-Häppchen hinzuwerfen, um ausgerechnet damit von echter Information abzuhalten. Das ist, als würde man einem Hungernden Brot nur zeigen und ihm gezielt verschweigen,
dass es essbar ist.
(Ich bin mir durchaus bewusst, dass ich mit solch harscher Kritik [scheinbar] genauso kleinkariert bin wie jene Klugscheißer-Wissenschaftler, die Popularisatoren jede auch noch so kleine Abweichung von der einzig wahren Lehre der Wissenschaft ankreiden.)
Bei sowas sprach sogar Richard Dawkins
(ansonsten ja ein ganz billiger Genfanatiker
[vgl. ![]() ] und fanatischer Atheist)
] und fanatischer Atheist)
mit Recht von
| "populistischer Prostitution, die das Staunenswerte an der Wissenschaft besudelt". |
(Damit man mich nicht falsch versteht: ich bin ja unbedingt für Popularisierung und da zu fast jedem Mittel bereit - und allemal dazu, allereinfachst anzufangen;
und überhaupt wüsste ich museumspädagogisch ganz genau, was ich tun würde:
Museen gestalten, in denen die Zuschauer fast gezwungen werden, sich nicht alles anzuschauen
[das kann nur erschlagen und somit erst zur Erniedrigung, dann - aus Notwehr - zur Ablehnung führen],
sondern sich zu spezialisieren;"Wurmfortsatz-Museen" gestalten:
In einem Innenkreis gibt es sozusagen "Zucker", d.h. wird man neugierig gemacht und "abgeholt"; und wenn einen dann ein Thema interessiert, kann man [als Angebot!] in den äußeren Ruhenischen Genaueres erfahren und immer tiefer in die Geheimnisse eindringen [Nebennischen von Nischen]:
[vielleicht erkennt man ja hier die Bibliothek aus Umberto Ecos Roman "Der Name der Rose" wieder, die ich hier allerdings nicht als Metapher für ein Labyrinth (Borges' "Die Bibliothek von Babel"), sondern im Gegenteil als Metapher für strukturierte Ordnung benutze].
Also innen Halligalli, aber je weiter man nach außen kommt, desto ruhiger und "intimer" wird es. Außen herrscht also fast "Andacht", bzw. da wird - schon allein durch räumliche Enge - den Besuchern ein gewisses "Benimm" abverlangt;
wenn die das noch können: in der Pieterskerk in Leiden tobt ja inzwischen auch ein Flohmarkt [Jesus hätte die Händler aus dem Tempel rausgepeitscht!], läuft Säuselmusik im Hintergrund und raucht man kräftig drauflos.)
Nein, Populärwissenschaft muss durchaus Ansprüche stellen (weil die Menschen ja nicht per se dumm, sondern durchaus neugierig sind), darf nicht unter Niveau gehen.
Das beste Mittel aber, nicht unter Niveau zu gehen, ist, dass Populärwissenschaft sich immer wieder an der vordersten Front der Wissenschaft und deren Fragen mißt: was dem Populärwissenschaftler nicht selbst schwer fällt, ist für das Publikum zu einfach.
Eine weiteres probates Mittel des Populärwissenschaftlers gegen Verdummung des Publikums und Halbwahrheiten ist die Dauerfrage: "habe ich selbst es denn wirklich verstanden, könnten simple Kinderfragen mein ganzes Pseudo-Verständnis wieder aushebeln?"
Natürlich wird einem vieles auf die Dauer durch Übung selbstverständlich, ja, muss es werden, damit man nicht immer wieder "bei Adam und Eva" anfangen muß und nicht so viel Zeit braucht. Dennoch sollte man sich ein paar Irritationen bewahren. So finde ich es ausgesprochen gut und wichtig, daß der (erstklassige!) Mathematiker Michael Guillen sich beim Limes dasselbe Unwohlsein bewahrt hat, wie auch die meisten SchülerInnen es haben. Der Limes ist handhabbar – und doch per se gehirnausrenkend.
Pseudo-Populärwissenschaft gibt es aber nicht nur im "Unter-Haltungs-", sondern durchaus auch im "gehobeneren" Bereich. Im hochgelobten Buch "Wege und Irrwege, Eine Geschichte der Mathematik" von Jeanne Peiffer und Amy Dahan-Dalmedico werden anfangs z.B. die Zahlensysteme, Zahl-Notations- und teilweise auch Rechenweisen der Babylonier und Ägypter vorgestellt. Aber doch derart dürftig, daß es unverständlich bleiben muß
(die ägyptischen Zahlzeichen wie "|", "∩" und "9" [nicht zu verwechseln mit unserer Neun] werden nichtmal definiert),
teilweise derart um die Ecke und unsystematisch, dass der Leser gezwungen ist, alles mühsam selbst zu erarbeiten bzw. wohl besser: sich zusammenzureimen. Daß das Buch schon dick genug ist und daher gerade die Anfänge der Mathematik nur andeuten kann, ist dabei keine Entschuldigung. Wenn ich keine Chance habe, das babylonische und ägyptische Rechnen wirklich zu verstehen, sollte man überhaupt nicht drauf eingehen. Oder was habe ich denn davon, wenn ich zwei Seiten lang die exotischen Namen arabischer Mathematiker erfahre, aber nichts über ihre Tätigkeiten außer vielleicht mal "Theorie der quadratischen Gleichungen" oder auch nur "Mathematiker in Nordafrika"?
Es gibt aber auch – spiegelbildlich zum "Wissenschafts-Populismus" - eine Pseudo-Populärwissenschaft, die in der reinen Wissenschaft verfangen bleibt und nicht weit genug "hinab" zu steigen fähig ist:
nichts gegen unumgängliche reine Fachwissenschaft, die eh nicht "alle", sondern nur Fachleute erreichen will: Hightech-Wissenschaft ist nunmal nicht für jeden verständlich, und wo kämen wir hin, wenn beispielsweise jeder Top-Physiker sich andauernd den "dümmsten" Laien erklären müsste?!
Aber alles gegen eine vorgebliche Populärwissenschaft, die eben nicht populär, d.h. verständlich ist, ja, sich gerade um Verständlichkeit und Anschaulichkeit überhaupt nicht bemüht: nichtmal aus Arroganz, sondern weil der Autor nach langer Beschäftigung mit seinem Thema überhaupt kein Gespür mehr dafür hat, daß seine Leser nicht so eingearbeitet sind.
Ein Beispiel: in einem Verlagsprospekt von Klett (immerhin doch einem Schulbuchverlag) erschien der unten abgedruckte Artikel von einem gewissen Prof. (!) Dr. (!) Harro Heuser über die Entdeckung des Grenzwertes (immerhin doch einer der Kardinal-Entdeckungen der Mathematik!). Und über dem Artikel stand dann auch noch ausdrücklich: "Auch zur Lektüre im Unterricht empfohlen"
(wobei unklar ist, ob Heuser selbst oder nur der Verlag diese Empfehlung ausgesprochen hat. Vielleicht hat Heuser den Artikel ja gar nicht für Schüler geschrieben).
Aber wie soll man denn solch einen Artikel im Unterricht vorlegen, wenn selbst ich als Mathematiklehrer ganze Passagen nicht verstehe?
Oder genau genommen: einiges habe ich gar nicht verstanden
(ich müsste es – wie z.B. die newtonschen Weg-Zeit-Gesetze x = x(t), y = y(t) und die Bahngleichung ax + x2 - y2 = 0 - erstmal nachschlagen und mühselig selbst entwickeln, denn unverstanden akzeptiere ich eh nichts),
bei anderem brauchte ich einige Zeit, um es mit meinem Vorwissen in Verbindung zu bringen.
Nun weiß ich ja auch, dass die Qualität eines Artikels nicht allein daran messbar ist, ob er alles erschöpfend erklärt (also vielleicht allzu suggestiv ist und somit dem Leser keine Freiheit für Selbsttätigkeit mehr lässt); sondern die Qualität kann auch darin liegen, dass der Artikel den Leser dazu anregt, fehlende Erklärungen selbst zu suchen, dass der Artikel den Leser also selbst zur Wissenschaft ermutigt. Dafür muss ein Artikel aber passagenweise anregend genug geschrieben sein und gegebenenfalls Tipps zur Weiterarbeit geben
(wie habe ich es im Mathe-Studium gehasst, wenn da stand: "daraus ergibt sich trivialerweise" – nur dass ich drei Tage am Nachvollzug einer solchen angeblichen Trivialität arbeiten mußte).
Von "Tipps" kann aber im hier vorliegenden Artikel keine Rede sein, und wenn ich alles nacharbeiten muss, ist nichts mehr anregend, sondern gebe ich (und SchülerInnen sowieso) frühzeitig frustriert auf bzw. verweigere mich einfach.
Solche Pseudo-Populärwissenschaft kann nur zwei Effekte haben:
entweder den, dass der Leser meint, (absichtlich?) als Dummkopf vorgeführt zu werden, und sich beschämt fühlt (wozu ich nicht neige);
oder den, daß er den Autor für pädagogisch unfähig hält
(wobei zu ergänzen ist: außerhalb der Populärwissenschaft verachte ich keinen Autor, nur weil er schlauer ist als ich).
Durchaus bewußt ist mir, daß auch Populärwissenschaft nicht für jeden verständlich sein kann, sondern ein gewisses Fundament und Vorwissen voraussetzen darf und muß. Wenn der Artikel also zur Lektüre im Unterricht empfohlen wird, so darf man wohl allemal voraussetzen: in einer Klasse, die gerade Analysis betreibt, also in einem Grund- oder Leistungskurs der 11. und 12. Klasse.
(Ein höchst heikler Punkt ist es da nebenbei auch, wenn es manchmal heißt, ein Buch setze "nur" Allgemeinwissen auf "Abiturniveau" voraus:
ist das ein völlig schwammiger Begriff,
ist bei den meisten Leuten das Abitur [das Maximum des Allgemeinwissens?] ja schon eine Ewigkeit her, d.h. sie können ihr Grundwissen im besten Fall nur - bei geeigneter Hilfe - reaktivieren.)
Ich halte diesen Artikel aber nichtmal in einem guten Leistungskurs für "machbar": die Schüler würden mir frustriert "mit dem Hintern ins Gesicht" springen!
Zumindest blieben allzu viele Ergänzungen (fast zu jedem Satz) dem Lehrer überlassen. Und eben das kann nicht Sinn eines zur Lektüre im Unterricht empfohlenen Artikels sein (womit ich mich ja vor Hilfestellungen hier und da, also der eigentlichen Lehreraufgabe, keineswegs drücken will). "Für den Unterricht empfohlen" muß aber doch wohl heißen: "nach Erarbeitung des nötigen Vorwissens von Schülern weitgehend ohne Hilfestellung durch den Lehrer verständlich".
Natürlich war die Entwicklung des Grenzwertbegriffs (wie eben dieser Begriff selbst) ungeheuer komplex, und deshalb ist sie keineswegs einfach darzustellen (zumal es keine lineare Entwicklung gab). Aber den guten Populärwissenschaftler macht es doch gerade aus, die komplexen Entwicklungen verständlich zu bündeln – ohne zu banalisieren.
Ich werfe dem Artikel nicht nur vor, daß er die Fakten (eben z.B. die newtonschen Gleichungen) nicht gut genug herleitet und erklärt (sondern hinknallt), sondern auch, daß er die Zusammenhänge nicht klar genug darstellt.
Worin besteht denn beispielsweise der Zusammenhang zwischen der Erkenntnis Antiphons und der des Hippokrates, wenn es da heißt?:
"Der Sophist Antiphon [...] gelangte [...] zu einem Polygon, das »wegen der Kleinheit seiner Seiten« mit dem Kreis übereinstimmt. Hippokrates [...] soll entdeckt haben, dass zwei Kreise [wohl Flächen zweier Kreise] sich zueinander verhalten wie die Quadrate [wohl Flächen der Quadrate] über ihren Durchmessern."
Die Quadrate des Hippokrates sind ja gerade nicht die Polygone des Antiphon, sondern hier findet ein enormer Sprung statt: von der geometrisch motivierten und einfachen, aber arithmetisch schwierigen "Ausschöpfung" durch Antiphon zur rein arithmetischen (und da sehr einfachen) Verhältnisgleichung des Hippokrates (und nebenbei: stimmt die Behauptung des Hippokrates überhaupt, und wenn ja, weshalb?). Der Zusammenhang ist nur höchst indirekt: Kreise eben doch mit Polygonen (bei Hippokrates eben Quadraten) in eine rein arithmetische Verbindung setzen (aber eben nicht mehr wie bei Antiphon "ausschöpfen") zu können.
Antiphon und Hippokrates so in einem Atemzug zu nennen, legt ja eben den Irrtum der Quadratur des Kreises nahe (was ein ganz anderes, seinerseits höchst interessantes Thema wäre).
Zweierlei sei da direkt angehängt:
bin ich mir nicht so sicher, ob ich das Problem überhaupt richtig verstanden habe (was an Heuser liegt!);
spreche ich hier natürlich auch wieder für einen Laien unverständlich. Aber mein Aufsatz richtet sich ja auch nicht an Laien, sondern an Fachleute der Populärwissenschaft (u.a. halt LehrerInnen).
Die gebotene Kürze solch eines Artikels kann da keine Entschuldigung sein. Besser gar nicht (oder zumindest nicht für SchülerInnen) als so:
Prof. Dr. Harro Heuser: Die Mühsal der Beweise
Die Analysis ist im Kern die Theorie der Grenzprozesse. Sie begann tastend mit näherungsweisen Berechnungen von Flächen und Volumina in Babylon und Ägypten. So bestimmten die Babylonier etwa die Fläche F eines Kreises mit Radius r nach der Formel: F = 3r2 . Die Ägypter dagegen rechneten: F = 3,16r2. Demokrit von Abdera (460 bis 371 v. Chr.), der Hauptvertreter der griechischen Atomistik, ermittelte das Volumen der Pyramide und des Zylinders. Ausgesprochen populär war das Problem der Kreismessung. Der Sophist Antiphon (geboren etwa 480 v. Chr.) wagte sich dabei an den ersten Grenzprozess: Er beschrieb dem Kreis eine Folge regulärer Polygone ein (wobei er die Zahl der Polygonseiten fortlaufend verdoppelte). Auf diese Weise gelangte er zu einem Polygon, das "wegen der Kleinheit seiner Seiten" mit dem Kreis übereinstimmt. Hippokrates von Chios (2. Hälfte des 5. Jh v. Chr.) soll entdeckt haben, dass zwei Kreise sich zueinander verhalten wie die Quadrate über ihren Durchmessern.
Doch schon in der Antike wurde betont, dass die Antiphonsche "Ausschöpfung" eines Kreises durch Polygone an der Tatsache scheitert, dass jede Ausdehnungsgröße beliebig unterteilt werden kann. Diese "Tatsache" war aber erst zu Antiphons Zeiten eine "Tatsache" geworden. In der enorm einflussreichen Schule des Pythagoras (um 570 bis 480 v. Chr.) hatte man nämlich an einen "atomaren" Aufbau der geometrischen Größen geglaubt. Eine Strecke etwa bestand dort aus endlich vielen unteilbaren "Atomlinien" (atomoigrammai). Die Atomstruktur machte es möglich, gleichartige Größen miteinander zu vergleichen. So verhielten sich die Längen zweier Strecken wie die Anzahl der in ihnen enthaltenen "Atomlinien". Doch dann entdeckte ein Pythagoreer um die Mitte des 5. Jh. v. Chr., dass es inkommensurable Strecken gibt. Strecken also, die man nicht mit derselben Längeneinheit messen kann. Seite und Diagonale eines Quadrats sind zum Beispiel inkommensurable Strecken. Denn die Diagonale des Einheitsquadrats hat die irrationale Länge . Die "Atomlinie" wäre eine Längeneinheit für alle Strecken gewesen. Das Phänomen der Inkommensurabilität besagte aber, dass es Atomlinien gar nicht gibt. Strecken (und alle anderen Größen) sind somit ins Unendliche teilbar. Dann können aber die "Bestandteile" einer Strecke nur ausdehnungslose Punkte sein. Dies kommentierte Aristoteles bissig: "Es ist absurd, dass eine Größe aus Dingen ohne Größe bestehen soll".
Eudoxos von Knidos (um 408 bis 347 v. Chr.) fand einen Ausweg aus der verfahrenen Lage. Er schuf eine ingeniöse geometrische Proportionenlehre. Von nun an konnte man auch ohne die Atomhypothese wieder von dem Verhältnis geometrischer Größen reden. Auf dieser Grundlage erarbeitete Eudoxos eine strenge Methode zum Beweis von Verhältnissätzen in der "Maßtheorie". (Also von Sätzen wie: "Zwei Kreise verhalten sich zueinander wie die Quadrate über ihren Durchmessern.") Im 17. Jh. fand man dafür den unglücklichen Ausdruck "Exhaustionsmethode" (Ausschöpfungsmethode), obwohl sie das Ausschöpfen im Sinne von Antiphon gerade vermeidet.
Sie beruht auf einem "Wegnahmesatz": Durch fortgesetztes Halbieren einer ersten Größe kann man immer unter eine zweite (gleichartige) Größe gelangen. Es scheint aber nur so, als hätten wir hier den Grenzwertbegriff in seinem Anfang vor uns. Der Wegnahmesatz und die Exhaustionsmethode beschäftigen sich nicht mit unendlichen Folgen. Im Wegnahmesatz hört das Wegnehmen nach endlich vielen Schritten auf. Und bei der Exhaustion tritt an die Stelle eines Grenzwertarguments ein Widerspruchsbeweis.
Ein unübertroffener Virtuose der Exhaustion war Archimedes (287 bis 212 v. Chr.). Ihm konnten selbst so geniale Denker wie Kepler (1571 bis 1630) und Galilei (1564 bis 1642) nicht folgen und flüchteten in eine Neuauflage des pythagoreischen Atomismus. Ihre "Verbesserung": Sie transmutierten die immerhin noch vorstellbaren "Atome" zu unvorstellbaren "Infinitesimalien" oder "Indivisiblen", die unendlich klein waren. Will heißen: Sie waren nichts und doch etwas, sie waren Nullen, aber nicht ganz und gar.
Neben dem Inhaltsproblem gab es noch das Tangenten- oder Geschwindigkeitsproblem. Man bearbeitete es durch Pseudogrenzübergänge, die darin bestanden, dass man "unendlich kleine" Terme ungeniert unter den Tisch fallen ließ. Im Jahr 1665 löste Newton (1642 bis 1727) die Aufgabe, die Beziehung zwischen den Geschwindigkeiten p, q zweier Körper A, B zu finden. Die Körper bewegen sich gemäß den Weg-Zeit-Gesetzen x = x(t), y = y(t) und der Bahngleichung ax + x2 - y2 = 0. Newton nahm an, dass ein Körper sich in einer "unendlich kleinen" Zeitspanne o so bewegt, als habe er konstante Geschwindigkeit. In dieser Spanne o legt also A die Strecke po und B die Strecke qo zurück. Wegen der Bahngleichung ist daher a(x + po) + (x + po)2 - (y + qo)2 = 0.
Wenn wir die Quadrate entwickeln, noch einmal die Bahngleichung betrachten und durch o dividieren, ergibt sich: ap +2xp - 2yq + p2 o – q2 o = 0.
Und hier sagte Newton: "Die Terme, in denen o enthalten ist, sind unendlich viel kleiner als die, in denen es nicht enthalten ist. Daher bleibt, wenn wir sie wegstreichen: ap +2xp - 2yq = 0." Das war die gesuchte Beziehung zwischen p und q. Man erkennt hier deutlich die schizophrene Rolle der "unendlich kleinen" Größe o, die manchmal ein Etwas, manchmal ein Nichts ist. Weil sie ein Etwas ist, darf Newton durch sie dividieren. Weil sie ein Nichts ist, darf er sie streichen - freilich erst, nachdem sie ihre Funktion als Etwas beim Dividieren brav erfüllt hat. Der Bischof und Erkenntniskritiker George Berkeley (1685 bis 1753) merkte ironisch an, dass Newton hier einen Taschenspielertrick praktiziere: Indem er o = 0 setze, "vernichte" er seine erste Annahme o ≠ 0, behalte aber die Folgerungen aus ihr bei. "All das," fährt der Gottesmann fort, "scheint mir eine höchst widerspruchsvolle Art der Beweisführung zu sein, wie man sie in der Theologie nicht erlauben würde."
Dem grüblerischen Newton war bei Infinitesimalbetrachtungen nie recht wohl gewesen. In der Abhandlung "De quadratura curvarum" griff er denn auch das Streichen der o-Terme mit den berühmten Worten an:. "In der Mathematik dürfen selbst die kleinsten Fehler nicht vernachlässigt werden." Newton ahnte, dass alle diese Misslichkeiten nur durch etwas völlig Neues - den noch gar nicht vorhandenen "Grenzprozess" - aus der Welt geschafft werden konnten. Die Anfänge einer Grenzwerttheorie entwickelte er in einer Reihe von Lemmata in seinem Hauptwerk "Principia mathematica philosophiae naturalis" von 1687. Wir blicken tief in das Spannungsverhältnis zwischen Archimedes und neueren Ansätzen, wenn wir lesen: "Diese Lemmata wurden voraus geschickt, um die Mühsal der verwickelten Widerspruchsbeweise nach der Art der alten Geometer zu vermeiden. Die Beweise mittels der Indivisiblenmethode sind zwar kürzer, aber da die Methode der Indivisiblen etwas anstößig ist ... , habe ich es vorgezogen, die Beweise der folgenden Sätze auf die ersten und letzten Summen und Verhältnisse entstehender und verschwindender Größen zurückzuführen." Die Methode der Indivisiblen ist "etwas anstößig", weil die geometrische Atomistik - wie er wenig später sagt - sich nicht mit dem verträgt, "was Euklid im 10. Buch der 'Elemente' über inkommensurable Größen bewiesen hat." An der Wiege des Grenzwertbegriffs steht das Phänomen der Inkommensurabilität.
Newtons Grenzwertbegriff ist noch wenig ausgereift. Das Präziseste sagte er im Zusammenhang mit dem Grenzwert eines Bruchs f(t)/g(t), bei dem Zähler und Nenner gegen 0 streben. (Also bei der Berechnung eines "unbestimmten Ausdrucks" 0/0.) Es liest sich so: "Die letzten Verhältnisse, mit denen Größen verschwinden, sind in Wirklichkeit nicht die Verhältnisse letzter Größen, sondern Grenzwerte (limites), denen sich die Verhältnisse unbegrenzt abnehmender Größen ständig nähern und jenen sie näher kommen als irgendeine vorgegebene Differenz, welche sie jedoch niemals überschreiten und auch nicht erreichen, bis die Größen in infinitum abgenommen haben." Mit Hilfe dieser Begriffsbildung gelang es ihm, seine "Fluxionsrechnung" (= Differenzialrechnung) als ein mächtiges Instrument zur Untersuchung veränderlicher Größen zu schaffen. Indem er in einer überraschenden Gedankenwendung eine Fläche als etwas Werdendes ansah und ihre Veränderung mittels dieser Fluxionsrechnung studierte, gewann er den Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung. Damit war es möglich, die sperrigen Flächenberechnungen durch "Antidifferenziationen" (= unbestimmte Integration) kalkülmäßig zu bewerkstelligen. Deshalb nannte man diese neue Methode denn auch treffend calculus ("Rechnung"). Der calculus stellt den ersten echten Fortschritt über Archimedes hinaus dar. Zu seiner enormen Fruchtbarkeit trug entscheidend der ausgiebige Gebrauch bei, den Newton von Potenzreihen machte. Denn da er diese Reihen (unbedenklich!) gliedweise ausdifferenzierte und integrierte, fielen praktisch alle damals gängigen Funktionen dem calculus anheim.
Ein wenig später als Newton - aber unabhängig von ihm - fand Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 bis 1716) seine Version der Differenzial- und Integralrechnung. Sie zeichnet sich aus durch eine suggestive Symbolik und eine starke Betonung des Kalkülhaften. Diese Faktoren haben den Siegeszug des calculus sehr begünstigt. Doch auf diese Dinge und auf das weitere Schicksal der Analysis (es war stürmisch!) kann an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden.
Der Artikel ist, wenn überhaupt, nur zu einer Sache nützlich: er gibt Stichworte zur Erarbeitung einer historischen Unterrichtsreihe.
Und dann gibt es noch pseudo-einfache Texte wie folgenden:
"Mit indirekten Methoden haben Zahlentheoretiker gezeigt, dass [eine gewisse] Regelmäßigkeit [der Primzahlen] unterbrochen wird, wenn die Primzahlen groß genug sind [...]. Der [...] Beweis dieser Tatsache funktionierte nur, wenn die Zahl größer ist als 10'10'10'10'46, wobei ich das '-Zeichen anstelle einer Potenzschreibweise verwendet habe, um den Drucker davor zu bewahren, Zustände zu kriegen. Diese Zahl ist gigantisch groß. Voll ausgeschrieben würde sie 10000 ... 000 lauten, mit einer sehr großen Anzahl Nullen. Wenn sich alle Materie des Universums in Papier verwandelte und eine Null auf jedes Elektron gedruckt werden könnte, stünden nicht genug Elektronen zur Verfügung, um auch nur einen kleinen Bruchteil der notwendigen Nullen unterzubringen."
Was Ian Steward
(immerhin - und wie ich finde, zu Unrecht - als "der" mathematische Populärwissenschaftler der Welt hochgejubelt)
da sagt, ist symptomatisch für sein ganzes Buch "Die Zahlen der Natur; Mathematik als Fenster zur Welt"
(was für ein grandioser Titel! Und wie gründlich gerade deshalb die Enttäuschung über dieses Buch!):
Stewards Bu(e)ch(er) kann man nur verstehen, wenn man sowieso schon Mathematiker ist, denn wer außerhalb der Mathematik weiß schon, was Potenzen sind und wie radikal Zehnerpotenzen explodieren
(und für Mathematiker könnte Steward genauso gut die echte Potenzschreibweise, also ![]() benutzen, die sogar kürzer als 10'10'10'10'46 ist [den Drucker also auch vor "Zuständen" bewahren würde] und wahrhaft nicht unverständlicher).
benutzen, die sogar kürzer als 10'10'10'10'46 ist [den Drucker also auch vor "Zuständen" bewahren würde] und wahrhaft nicht unverständlicher).
Oder was soll denn dieser Quatsch von wegen "10000 ... 000"?! Die sagenhaft große Anzahl der Nullen wird in dieser Schreibweise ja gerade nicht klar. Oder was soll denn dieser bescheuerte Satz
"Wenn sich alle Materie des Universums in Papier verwandelte und eine Null auf jedes Elektron gedruckt werden könnte, stünden nicht genug Elektronen zur Verfügung, um auch nur einen kleinen Bruchteil der notwendigen Nullen unterzubringen",
der verzweifelt "anschaulich" und doch
dermaßen um die Ecke gedacht ist, daß ihn ein Außenstehender sowieso
nicht verstehen wird? Das geht doch viel einfacher: "die Zahl ![]() ist weit größer als die Anzahl sämtlicher Elektronen im Weltall".
ist weit größer als die Anzahl sämtlicher Elektronen im Weltall".
Flapsigkeiten wie "um den Drucker davor zu bewahren, Zustände zu kriegen" ersetzen keine Erklärung, sondern sollen nur über das Unvermögen, sie zu liefern, hinwegtäuschen!
Ich verstehe Steward einfach nicht:
entweder er schreibt für Mathematiker, und dann sollte er nicht so verschämt sein, knallharte Mathematik (also z.B. Gleichungen oder einfach Zahlen) zu vermeiden;
oder er schreibt für Laien, und dann müsste er viel besser erklären.
Mir scheint, allzu viele (Populär-)Mathematiker schämen sich ihres Handwerkszeugs, finden es selbst "irgendwie" unseriös oder resignieren zu früh vor Vorurteilen - und verbergen all ihr Wissen deshalb so verschämt.
Einerseits sollte man natürlich nicht mit Zahlen angeben und abschrecken, sondern nur so viele wie gerade eben nötig benutzen.
Andererseits besteht Mathematik nunmal integral aus Zahlen und Rechnungen, müssen sie also auch gezeigt, nur dann eben auch erklärt
werden. Der Formalismus der Mathematik mag auf viele Leute
eiskalt-abstrakt und abschreckend wirken. Dennoch und gleichzeitig ist
er aber doch auch der enorme Vorteil der Mathematik – und manchmal sehr ästhetisch.
Da liebe ich mir doch
"An mehreren Stellen in diesem Buch habe ich mich unverfroren mathematischer Formeln bedient und damit die häufig ausgesprochene Warnung missachtet, dass jede solche Formel den Leserkreis halbieren wird."
(Roger Penrose)
Beides wäre zu vermitteln!
Es wäre in der Tat mal an der Zeit, ein (populärwissenschaftliches) Buch nicht über die inhaltlichen, sondern über die formalen Fortschritte der Mathematik zu schreiben: dass heute alles ganz wunderbar einfach und kurz (aber eben auch sehr abgenagt) formuliert werden kann, was beispielsweise Newton noch umständlichst in Wörtern ausdrücken musste. Die Menschen der Gegenwart (SchülerInnen) wären plötzlich heilfroh über diesen Formalismus.
Wer Menschen völlig die Zahlen und Rechnungen vorenthält, enthält ihnen auch den Weg zu Erkenntnissen vor und verkauft sie deshalb a priori für dumm (obwohl der Weg oftmals nicht mit Zahlen, sondern mit Bildern und ästhetischen Annahmen anfing).
Gute Populärwissenschaft muss fallweise zweierlei leisten:
entweder die hohe Wissenschaft 1:1 veranschaulichen
oder den Mut zur nötigen Simplifizierung haben.
Mit dem 1:1 meine ich, dass es oftmals durchaus möglich ist, Wissenschaft verlustfrei zu übersetzen: die populäre Darstellung stellt dasselbe nur anders dar (vgl. das ersten Beispiel unten).
In anderen Fällen ist ein Verlust nunmal nicht vermeidbar: die darzustellende Wissenschaft ist derart abstrakt, dass sie in ihrer ganzen Fülle gar nicht mehr veranschaulichbar ist, ja, dass selbst die Fachwissenschaftler sie zwar logisch betreiben, aber sich nicht veranschaulichen können. Das ist beispielsweise der Fall, wenn die Relativitäts- und Quantentheorie nur noch mit mathematischen Sonden in eine (durchaus vorhandene, voraussagbare und überprüfbare) Wirklichkeit vordringen kann, die aber aus prinzipiellen Gründen nicht mehr anschaulich erfahren werden kann. Wenn da dann beispielsweise von Eigenschaften "up" und "down" die Rede ist, so sind das nicht mal mehr (wie Enzensberger meinte) Metaphern, sondern rein willkürliche Bezeichnungen für innermathematische Ergebnisse.
Im letzteren Fall (vgl. das zweite Beispiel unten) sind nur noch Analogien möglich! Und Analogien haben nunmal den unumgänglichen Nachteil, dass die Vergleichsebenen nicht mehr in allen Punkten übereinstimmen: ein unvermeidbarer und doch zur Veranschaulichung nötiger "Reibungsverlust". Im besten Falle stellt ein Populärwissenschaftler dann auch immer dar, was der Vergleich bzw. die Analogie positiv leistet, wo sie aber auch haken und nicht mit dem Original übereinstimmen
(bester Nebeneffekt dabei ist, dass etwas überhaupt für Wissenschaften Zentrales deutlich wird: wie gut Theorien und Modelle die Wirklichkeit beschreiben, dass sie aber nicht die Wirklichkeit sind).
Denn das wäre auch fatal und allzu billig: die Populärwissenschaft als die Wissenschaft selbst zu verkaufen.
Jetzt aber zu meinem eigentlichen Thema: meinem grenzenlosen Respekt vor populärwissenschaftlichen Meisterleistungen, ja, fast schon meinem Neid darauf
(ob die ersten beiden Beispiele wirklich von Singh bzw. Ditfurth stammen oder von diesen wiederum woanders geklaut wurden, ist dabei unerheblich, mindert nämlich nicht ihre Qualität;
mag also sein, dass der Begriff "Uhrmathematik" schon lange vor Singh in der Mathematik eingebürgert war;
mag ebenso sein, dass erst Singh ihn erfunden hat.
Er ist allemal treffend und nicht nur ein hübscher, entkrampfender Gag wie bei Enzensberger in seinem ansonsten wirklich wunderschönen Buch "Der Zahlenteufel", der "die Wurzel ziehen" in "den Rettich ziehen" übersetzt;
mag nebenbei auch sein, dass andere LehrerInnen dieses Beispiel der "Uhrmathematik" schön längst kennen und ich nur mal wieder arg spät dran bin: auch das stört mich nicht: es geht mir ums Prinzip bisher noch unbekannter Veranschaulichungen).
Vorweg sei aber der Populärwissenschaftler gewürdigt, den ich bewundere wie keinen anderen:

Hoimar von Ditfurth
1. Beispiel
(das mich tatsächlich ein wenig beschämt hat: warum bin ich – verdammt nochmal! - nicht selbst drauf gekommen, wo ich es doch so gut und oft im Unterricht hätte gebrauchen können?)
Üblicherweise in der 5. Klasse nimmt man verschiedene Zahlensysteme durch. Letztlich geht es dabei nicht darum, dass die SchülerInnen diese anderen Zahlensysteme behalten (sie vergessen meiner Privatstatistik nach alles), sondern der Sinn ist ein doppelter:
sollen die SchülerInnen "mathematisch denken" lernen: sie sollen lernen, dass ein Zahlensystem in jedes andere übersetzbar ist und dass keins davon prinzipiell besser oder schlechter ist. Es ist alles nur Gewohnheitssache: wir haben nunmal das Zehner- bzw. Dezimalsystem, und durch lange Gewöhnung erscheint es uns besonders einfach und macht es uns größte Schwierigkeiten, es in andere Systeme zu übersetzen (selbst der beste Mathematiker kann das nicht problemlos). Menschen mit einem Zwölfer-System hätten aber genau dieselben Schwierigkeiten, unser Zehnersystem zu verstehen, es als "normal" und "genauso gut" zu akzeptieren und in es hin und her zu übersetzen. Und Computer rechnen sowieso nur im Zweiersystem ("Strom oder nicht Strom, das ist hier die Frage") - und rechnen doch prächtig;
dienen all die Übersetzungen in andere Zahlensysteme nur dazu, den SchülerInnen die Funktionsweise unseres Zehner-Systems durch Analogie deutlicher zu machen:
dass also dreierlei gilt:
, dass z.B. 1 0 7 2 eine genial einfache Abkürzung für 1 · 1000 + 0 · 100 + 7 · 10 + 2 (·1) ist,
, dass unser Zahlensystem (anders als das römische) ein Stellenwertsystem ist: es ist eben nicht egal, wo eine Ziffer steht: 1072 DM sind etwas anderes als 1027 DM!
, dass die Null eine geniale Leistung in diesem Stellenwertsystem ist: sie bedeutet "nichts" ("Null Komma nix") und unterscheidet dennoch 1072 DM von 172 DM. Genial ist daran eben, daß die Inder überhaupt auf die Idee kamen, für "nichts" dennoch ein Zeichen einzuführen.
Ich persönlich halte es dennoch für Blödsinn, 5.-Klässlern andere Zahlensysteme als unser Zehnersystem beizubringen: es macht ihnen zwar durchaus Spaß, aber sie vergessen doch alles. Und da bin ich doch allemal dafür, etwas durchzunehmen, was
a) später noch brauchbar ist und
b) mathematische Denkweisen trainiert.
Anders gesagt: man kann die besonderen Leistungen des Zehnersystems durchaus auch [wie in a) – c) ] klar machen, ohne auf andere Zahlensysteme zurückzugreifen. Mehr noch: ich bin fest überzeugt, dass andere Zahlensysteme auf die Dauer die kognitiven Möglichkeiten von Zehnjährigen überfordern!
Aber wenn man schon andere Zahlensysteme durchnehmen will, sollte man es möglichst anschaulich machen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber ich habe noch nie solch eine geniale wie die von Simon Singh gesehen, nämlich die von ihm so benannte "Uhr-Mathematik".
Normalerweise sind wir es gewohnt, Zahlen auf dem Zahlenstrahl bzw. – unmathematisch ausgedrückt – "linear" zu denken: auf dem Zollstock kommt rechts von der 1 die 2 und rechts von der 2 die 3 usw. bis in alle Ewigkeit.
Ganz anders funktioniert aber die Uhr: nach der 12 kommt eben nicht die 13, sondern ein Rücksprung zur 1.
Und genau dieses Uhrprinzip hat Singh eben zur Veranschaulichung der Zahlensysteme benützt. Sein Trick ist, den Zahlenstrahl nicht mehr linear anzuordnen, sondern rund wie eben die Uhr (und dann mehrere Uhren nebeneinander).
Die Uhr ist nebenbei ein besonders günstiges Beispiel. Ihr Zwölfersystem ist das einzige andere System als das Zehnersystem, das wir überhaupt noch kennen. Und genau an der Uhr läßt sich noch etwas anderes Wichtiges zeigen: wir sind es durchweg gewohnt, im Zehner- bzw. Hundertersystem zu rechnen
(SchülerInnen weigern sich grundweg zu akzeptieren, dass man den Nullpunkt der Temperaturen woanders als beim Gefrierpunkt vom Wasser und den 1000-Punkt woanders als beim Siedepunkt von Wasser anordnen und den Zwischenraum zwischen beiden z.B. in gleichgroße 27 Teile unterteilen könnte).
Genauso erscheint es uns aber – anhand eben des einzigen anderen gewohnten, nämlich 12er-Systems der Uhr – völlig undenkbar, Zeit plötzlich im sonst so gewohnten Zehnersystem zu denken (was ja doch durchaus möglich wäre): der Tag würde in 10 statt 12 (bzw. 24) Stunden unterteilt (wobei jede Stunde nur länger wäre); der Tag selbst bliebe aber fest (nämlich die gleiche Distanz z.B. von Mitternacht zu Mitternacht), die Woche hätte 10 Tage, der Monat 10 Wochen, das Jahr 10 Monate
(nun, spätestens da gäbe es Probleme: es wären 10 · 10 · 10 = 1000 Tage, also erheblich zu lang für einen Umlauf der Erde um die Sonne bzw. – anschaulicher gesagt – die Distanz von Sommer zu Sommer).
Kurz gesagt: das Zwölfersystem der Uhr ist die einzige Chance, das Zehnersystem mal aufzubrechen bzw. nicht mehr ganz so selbstverständlich erscheinen zu lassen.
Ich würde also sämtliche Behandlung anderer Zahlensysteme mit dem Zwölfersystem beginnen
(was nebenbei durchaus auch Nachteile hat, nämlich – wo wir ja eigentlich nicht mehr im Zehnersystem arbeiten dürften – die Einführung zweier neuer Zeichen erfordern würde: z.B. ¥ für die Zehn und œ für die Elf; und doch: wie Singhs und jede Uhr zeigt, geht es auch ohne die Einführung solcher neuer Zeichen; kleinere Systeme als das 10er-System wären aber doch einfacher, weil die Einführung neuer Zeichen unnötig wäre).
Nur eine Kleinigkeit ändern wir: statt der Zwölf steht eine Null. Auch das sollte nicht ganz ungewöhnlich sein, weil doch jeder weiß, dass 2 · 12 = 24 Uhr dasselbe wie Null Uhr ist: zum Jahreswechsel feiern wir ja schließlich nicht das Ende des alten Jahres (Sylvester 24 Uhr), sondern den Anfang des neuen Jahres (Neujahr 0 Uhr).
Auf der neuen 12er-Uhr gilt nun zweierlei:
kommt die 12 überhaupt nicht vor (so, wie im Zehnersystem die Zehn [10] nicht direkt, sondern nur als Kombination von "1" und "0" vorkommt);
ergeben sich merkwürdige Ergebnisse: z.B. ergibt 11 + 2 nicht mehr - wie im (undurchschauten) Zehnersystem - 13 (was ja wohl heißt: 1 · 10 + 3), sondern merkwürdigerweise 1: wenn ich die Uhr von 11 Uhr um zwei Stunden vorstelle, ist es 1 Uhr. Also
11 + 2 = 1
Genau genommen müsste natürlich gesagt werden:
11 Stunden + 2 Stunden = 1 Tag + 1 Stunde, bzw. im 12er-System: 11 (= 1 Tag + 1 Stunde).
Unter der Voraussetzung, dass gilt: der Tag hat 12 (bzw. 24) Stunden, die Woche hat 12 Tage, der Monat 12 Wochen, das Jahr 12 Monate, könnte man nun einfach mehrere gleichartige 12er-Uhren nebeneinander anordnen: eine für die Stunden, eine für die Tage, eine für die Monate usw.
Und das ließe sich beispielsweise alles genauso anhand einer 5er-Uhr ins 5er-System übersetzen: der Tag würde in 5 statt 12 (bzw. 24) Stunden unterteilt (wobei jede Stunde nur länger wäre; der Tag selbst bliebe aber fest, nämlich die gleiche Distanz von Mitternacht zu Mitternacht), die Woche hätte 5 Tage, der Monat 5 Wochen, das Jahr 5 Monate.
Es wird doch dringend Zeit, solche Serien von Uhren zu "bauen" (2er-Uhren, 3er-Uhren usw.).
Singhs Uhrbeispiel ist, das sei wiederholt, ein Beispiel dafür, dass Wissenschaft ohne Verlust veranschaulicht werden kann: es tut den verschiedenen Zahlensystemen nicht den mindesten Abbruch, wenn man sie durch Uhren verdeutlicht, es wird kein einziger Aspekt unterschlagen.
(Ich habe natürlich prompt Singhs Idee "geklaut" und ein Programm dazu geschrieben. Vgl. ![]() .)
.)
2. Beispiel
Wir Menschen haben nunmal nur eine halbwegs verlässliche Wahrnehmung für drei Dimensionen (Höhe, Breite, Tiefe) und nur eine ziemlich unzuverlässige für die vierte Dimension (Zeit). Schon gar nicht können wir die vier Dimensionen in Zusammenhang sehen, bzw. wir müssen uns mit einigen "Krücken" helfen:
es ist nicht nur interessant,
wo der Ball ist (Breite = nicht seitlich vom Tor, Höhe = nicht überm Tor, Tiefe = hinter der Torlinie),
sondern auch, wann er da ist (also während des Spiels und nicht vor oder nach ihm).
Nur unter diesen vier Bedingungen (Breite, Höhe, Tiefe, Zeit) ist ein reguläres Fußballtor erreicht.
Wir sind also, um es kurz zu sagen, blind für die vierte Dimension der Relativitätstheorie, und deshalb neigen wir dazu, sie völlig zu leugnen oder gar für Blödsinn zu halten.
Ditfurths folgende Erklärung reduziert die wissenschaftliche Wirklichkeit auf Anschauungsniveau (lässt nämlich die vierte Dimension weg) und vereinfacht somit notgedrungen. Aber Hoimar von Ditfurth zeigt uns ja auch gar nicht (was fast aussichtslos wäre) die vierte Dimension, sondern unsere Blindheit für diese.
Er parallelisiert unsere (menschliche) Blindheit mit der andersgearteten Blindheit einer Ameise (ob Ameisen wirklich so "dumm" bzw. dimensional beschränkt sind, ist da eine ganz andere Frage):
so, wie wir eine vierte Dimension nicht wahrhaben können, geht es der Ameise mit der dritten Dimension: sie läuft beispielsweise auf einer riesigen Kugel herum und meint, immer geradeaus zu laufen, geht aber in Wirklichkeit rund um die Kugel und kommt irgendwann wieder am Ausgangspunkt an.
(Nebenbei: genauso ist es im Weltall incl. vierter Dimension: wenn wir – in unserer menschlichen Anschauung - immer geradeaus fliegen würden, kämen wir laut Relativitätstheorie nach ca. 20 Milliarden Jahren letztlich auch wieder an unserem Ausgangspunkt, der Erde, an.)
Ditfurths Beispiel ist auch deshalb so gut, weil wir Menschen gar nicht viel intelligenter als die Ameise sind: wir "wissen" zwar, daß die Erde eine Kugel ist, "glauben" das aber im Alltag nicht, sondern halten sie für eine flache Scheibe (der Gegensatz von "Wissen" und "Glauben" ist ja gerade die "Schizophrenie" des neuzeitlichen Menschen). Uns würde geradezu schwindlig, wenn wir permanent wüssten, dass die Erde eine Kugel ist und wir uns im Dreidimensionalen bewegen.
Nur ab und zu denken wir staunend an die Kugelgestalt der Erde: zwar haben wir von der Schwerkraft gehört, aber uns überkommt (in gleicher "Schizophrenie") doch ab und zu der Gedanke: "die armen Menschen in Neuseeland müssen andauernd mit dem Kopf nach unten gehen".
(Nebenbei: höchst lesenswert ist da nach wie vor das Buch
von Edwin A. Abbott, das in einem rein zweidimensionalen Land spielt.)
3. Beispiel
Ich hatte oben erwähnt, dass ich mich durch so manche populärwissenschaftliche Meisterleistung geradezu beschämt fühle.
Umgekehrt bin ich den Populärwissenschaftlern natürlich auch einfach nur dankbar für Erkenntnisse, die ich zwar nicht selbst hatte, aber doch wunderbar brauchen und klauen kann.
Ich finde Schulmathematik erheblich zu unanschaulich und bin der festen Meinung, dass alles durchaus viel anschaulicher möglich wäre. Aber ich werfe das Fehlen von Anschaulichkeit keineswegs (nur) anderen vor, sondern beklage durchaus auch meine eigene Phantasielosigkeit (und Faulheit?).
Umgekehrt habe ich durchaus ein gesundes Selbstbewusstsein (einen Touch von Genialität), ja, halte ich Veranschaulichung für eine meiner besonderen Fähigkeiten.
Ich bin z.B. durchaus stolz auf meine simple Erklärung der "vollständigen Induktion".
Dieses spezielle, für Schüler wohl verständliche, aber doch so schwer zu akzeptierende und schwer übertragbare mathematische Beweisverfahren erklärt Singh folgendermaßen:
Mathematiker würden zweierlei zeigen:
, dass der erste Dominostein umfällt,
, dass, wenn irgendein Dominostein umfällt, auch der nächste umfällt (etwa, weil alle im richtigen Abstand zueinander stehen, was bei unendlich vielen Dominosteinen allerdings kaum zu erkennen sein dürfte)
Daraus folgt dann: wenn mit
der erste Dominostein umfällt, dann fällt mit
auch der zweite, fällt mit
auch der dritte, fällt mit
auch der vierte
usw. bis in alle Ewigkeit.
Der Gag an dieser "vollständigen Induktion" ist also, dass man mittels zweier kleiner Beweise alle, ja, fast unvorstellbar: unendlich viele Fälle erledigen kann.
Man stelle sich die Alternative vor: man müsste den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten Fall usw. je einzeln beweisen (jeweils ein Arbeitsaufwand wie in a) – und würde doch nie fertig, weil immer unendlich viele Fälle unerledigt blieben.
So einfach Singhs Analogie aussieht, so stört mich doch was an ihr: wie zeigt man in a), dass der erste Dominostein umfällt (umfallen kann)? Was an ihm macht das Umfallen aus? Und umgekehrt gefragt: wie zeige ich das Gegenteil (das ja auch eintreten könnte und die gesamte "vollständige Induktion" von Anfang an scheitern lassen würde), dass also der erste Dominostein nicht umfällt? Indem ich wochenlang dran rüttle und er partout stehen bleibt?
Und genauso ist b), dass also der nächste Dominostein umfällt, für mich keineswegs klar: ich habe so einige Mal "Domino" gespielt und war mir sicher, daß der nächste Stein auch umfällt (günstig stand) – und trotzdem hat "irgendwas" gehakt, d.h., fiel der nächste Stein eben nicht um.
Da halte ich meine Veranschaulichung doch für erheblich besser: ich zeige
, dass die erste Ampel grün ist (wenn sie rot ist, brauche ich erst gar nicht weiterzumachen),
, dass, wenn irgendeine Ampel grün ist, auch die nächste grün ist (weil ein Automatismus sie zeitversetzt und der Fahrgeschwindigkeit entsprechend schaltet)
(nebenbei ist es typisch mathematisch gedacht, von Widrigkeiten wie z.B. falscher Geschwindigkeit oder einem Stau abzusehen, aber natürlich auch davon, daß es weder unendlich viele Ampeln gibt).
Wenn also mit
a) die erste Ampel grün ist (ob das so ist, sehe ich mit einem Blick!), ist mit
b) auch die zweite und mit
b) auch die dritte und mit
b) auch die vierte usw. bis in alle Ewigkeit grün.
Und dann spricht man eben von "grüner (Ampel-)Welle".
Der Vorteil meiner Erklärung scheint mir nun darin zu bestehen, dass ich sie zeigen kann: das Grün der ersten Ampel und die Schaltungslogik der gesamten Ampelanlage
(jede folgende Ampel wird eine Minute später auf grün geschaltet, wenn man für den Weg zu ihr bei konstanter Geschwindigkeit eben genau eine Minute braucht).
Nebenbei: was "vollständige Induktion" wirklich ausmacht, habe ich auch erst richtig verstanden und ist mir erst in Fleisch und Blut übergegangen, als mir die "Grüne-Welle"-Analogie einfiel. Seit ich diese Analogie im Kopf habe, macht mir plötzlich die Übertragung des Prinzips auf andere Fälle keine Schwierigkeiten mehr (wohl aber natürlich fallweise der Einzelbeweis, denn vollständige Induktionen können durchaus teuflisch sein).
Gekonnte, glückende Populärwissenschaft stelle ich mir keineswegs einfach, sondern vielmehr ausgesprochen schwierig und problematisch vor.
Ein Beispiel aus der Mathematik: in ihr werden oftmals scheinbare "Anwendungsaufgaben" benutzt, um überhaupt noch Alltagsnähe zu simulieren. Diese Aufgaben sind dann aber oftmals dermaßen um die Ecke gedacht ("wenn ich halb so alt bin wie meine Mutter vor 10 Jahren, wie alt wird dann mein Vater in 180 Jahren sein?"), dass sie nur noch hirnausrenkend abstrus wirken.
Für solch bescheuerte Aufgaben gibt es zwei Gründe:
entweder sind sie rückübersetzte Mathematik
("mit welcher Aufgabe kann man den Dreisatz beibringen?"),
oder sie sind völlig lebensfern, weil Leben nunmal gar nicht oder nur höchst kompliziert zu berechnen ist
(anders und ein wenig zynisch gesagt: die SchülerInnen können heilfroh sein, nicht mit echten und teuflisch komplexen Anwendungsaufgaben konfrontiert zu werden; und doch ist es ein Fehler, den Schülern die Schwierigkeiten [und die kleinen Erfolge!] der Mathematisierung völlig vorzuenthalten).
Mit solchen Anwendungsaufgaben ist es also wahrhaft ein Kreuz:
einerseits sind Mathematiker verzweifelt darauf angewiesen zu veranschaulichen, also einen Weg von der Alltagsanschauung zur mathematischen Denkweise aufzuweisen
(und auch für sich selbst immer wieder zu erschaffen, denn ganz ohne Anschauung kommen ja auch sie selbst nicht aus: mathematische Symbole sind für sie oftmals reale Dinge, x2 ist ein Quadrat, x3 ist ein Würfel - und x4 die Hinzufügung einer Dimension wie von x2 nach x3 );
andererseits ist Mathematik ja gerade die Abstraktion von der Komplexität des Alltags und kann nur dann Erfolge haben
(wobei am erstaunlichsten ist, dass nach Abstraktion von der Komplexität des Alltags und nach langwieriger, rein innermathematischer Rechnung dann oftmals doch wieder hilfreiche Rückschlüsse auf Phänomene des Alltags möglich sind).
Zentrales Problem bei der Vermittlung mathematischer Denkweisen ist also die (vereinfachende) Modellierung, d.h. auch irgendwann der (zwischenzeitliche) Abschied von den Alltagsvorstellungen. Und da muss zweierlei gezeigt werden:
Modelle sind
nur ein dumpfer Abklatsch der lebendigen Wirklichkeit
und doch hilfreich, ja, oftmals der einzig gangbare Weg.
Ich mache mir also wahrhaft nicht vor, sowohl die Vermittlung mathematischer Denkweisen als auch der Weg in sie hinein seien einfach. Sie können nur so einfach und überzeugend wie irgend möglich gestaltet werden, und selbst dann werden immer Schwierigkeiten der Kommunikation zwischen "Fachmann" und Laien bleiben. Da
muss halt der Laie selbstbewusst nachfragen
(was oftmals auch hübsch die scheinbaren Sicherheiten des Fachmanns in Frage stellt)
und muss der "Fachmann" versuchen, noch einfacher zu werden und noch bessere Beispiele zu finden
(und sich die Verständnisschwierigkeit des Laien überhaupt klar zu machen; denn der Laie weiß ja oftmals vor lauter Problemen gar nicht, wo es hakt).
Trotz besten Willens auf beiden Seiten sind in der Kommunikation zwischen Fachmann und Laien Frustrationen unvermeidbar:
der Fachmann (und auch Lehrer) denkt irgendwann: "ich erkläre es doch schon so einfach, wie nur irgend möglich; und noch einfacher geht's nicht"; ja, dann kommt beim Fachmann unvermeidbar auch mal ein doppelter Gedanke auf: "1.: wie kann man eigentlich so blöd sein, das nicht zu verstehen? 2.: ich bin ein schlechter Vermittler, unfähig, mich überhaupt noch verständlich zu machen, ja, selbst der einzige Unnormale, ja, Verrückte";
und der Laie denkt: "ich fühle mich verschaukelt, reingelegt – und beschämt"
In solchen Situationen gibt's nur eins: Pause machen, abschalten (also Distanz finden) und dann erneut (auf beiden Seiten) nachdenken und das Problem gemeinsam neu angehen.
Ein zentraler Unterschied zwischen Laien und Mathematikern ist wohl, dass für erstere Mathematik im besten Fall dazu dient, Außenwelt zu erklären (Mathematik als Hilfswissenschaft), während für letztere umgekehrt Außenwelt nur dazu dient, Mathematik vorstellbar zu machen bzw. zu halten (Mathematik als Selbstzweck, was Laien wie ein Paralleluniversum oder Bermudadreieck erscheinen muss). Der Weg von ersterer zu letzterer Perspektive ist so teuflisch schwierig und wohl nur langsam und immer mal wieder kurzfristig gangbar.
Ohne nun die vielleicht besonderen (besonders großen?) Probleme der Vermittlung von Mathematik zu bagatellisieren, sind das aber doch Probleme, die sich bei der Einführung in jede Wissenschaft ergeben, denn jede Wissenschaft ist eine spezialisierte Denk- und Sichtweise auf die Wirklichkeit: man muss sich erst dran gewöhnen, die Welt durch eine spezielle Brille zu sehen, mit der man bestimmte Details besser sieht (und andere schlechter); und man muss (auch zur Korrektur der Wissenschaft an der Wirklichkeit) die Brille ab und zu wieder absetzen können.
Der Vorteil des populärwissenschaftlichen "Fachmanns" ist aber, dass er Fachmann und (im Alltagsleben) Laie ist: die Wissenschaft ist ihm nie ganz selbstverständlich geworden, er kennt die Anfängerfragen und –schwierigkeiten noch von sich selbst bzw. hat die einmalige Chance, immer wieder im Kontakt mit Anfängern daran erinnert zu werden: vielleicht hatte Einstein die besten Ideen bzw. wurden sie erst ihm selbst anschaulich, wenn er sie Laien (oder dem glücklich bewahrten, vorlauten und respektlosen Laien in ihm selbst) vermitteln und immer wieder neu und noch einfacher, noch anschaulicher formulieren musste.
Beim Anwendungsaufgabenproblem wurde bisher immer von direkter Kommunikation zwischen Fachmann und Laien (bzw. Lehrer und Schüler) ausgegangen.
Bei schriftlicher Populärliteratur erfährt der Fachmann aber nie, dass der Laie etwas nicht versteht, und umgekehrt kann der Laie auch nie den Fachmann anregen.
Da muß dann der Fachmann noch sehr viel mehr leisten, nämlich selbst den Laien und Gegenspieler, ja, advocatus diaboli spielen
(und sei's, dass der Fachmann einen Fachmann-Laien-Dialog erfindet wie etwa Platon oder Galilei, in dem der erfundene Laie ernst genommen und nicht nur für Frontalunterricht benutzt wird).
Der Fachmann muss sich seiner eigenen ehemaligen und noch lange nicht überwundenen "dummen" Fragen erinnern. Fast scheint mir gar, schriftlich popularisieren kann nur, wer auch immer mal wieder (etwa als Lehrer) in echter Kommunikation popularisiert.
Kommt als Vorteil hinzu, dass der Popularisator meist ja – gegenüber den eigentlichen Fachleuten - auch nur Laie und Schüler ist.
Ein weiteres Problem ist, dass der (schreibende) Populärwissenschaftler das individuelle Vorwissen seiner jeweiligen Leser nicht kennt.
Ich könnte mir da vorstellen, dass der Autor sein Buch deshalb offen gestaltet (man kann überall anfangen, in jeder Reihenfolge lesen und auch einiges weglassen).
Im Idealfall stelle ich es mir aber so vor, dass der Popularisator sogar dem Fachmann neue Zusammenhänge aufzeigen bzw. den Effekt vermitteln kann: "unglaublich, daß man es auch mal so (einfach) sehen kann." Vielleicht staunt der Fachmann auch, wenn er seine eigenen Erkenntnisse mal in größere Zusammenhänge gestellt sieht.
| PS: | Das Problem der Populärwissenschaftlichkeit stellt sich nebenbei genauso in Geisteswissenschaften. Also: wie aber könnte germanistische Populärwissenschaft aussehen? Der Durchschnittsleser, der Jahre nach dem Abitur vielleicht doch (noch-)mal den "Faust" (wo der doch so berühmt und angeblich wichtig ist) lesen will, ist ja schnell durch die Fremdheit der Sprache wie die vielen unklaren damaligen Anspielungen überfordert. Nun kann er sich ja durchaus vorhandene (Reclam-)Kommentare und Worterklärungen oder auch fachwissenschaftliche Bücher über den "Faust" holen (aber womit anfangen, ist die Sekundärliteratur zum "Faust" doch erschlagend?!). Die Kommentare und Worterklärungen sind aber eine echte Zumutung, weil man dann ja immer zwei Bücher gleichzeitig (den "Faust" und den Kommentar) handhaben bzw. zumindest doch andauernd hin- und herschlagen muss: zwischen dem Originaltext vorne und den Anmerkungen hinten. Sowas macht einem das Lesen auf die Dauer sehr mühsam, ja, zerstört seinen Fluss ja gerade. Die gängigen Sekundärtexte hingegen sind meist derart knochentrocken, daß sie wohl kaum Lust auf den "Faust" machen. Wie also mit dem Problem umgehen? Nun, da bedarf es des Muts zur Popularität, ja, auch zur Pädagogik. Einen möglichen Trick haben die beiden italienischen Krimi-Schreiber Fruttero und Lucenti mit ihrem Buch "Die Wahrheit über den Fall D." vorgemacht. In diesem Buch steht nicht nur das vollständige Fragment eines Romans von Charles Dickens, sondern gerade weil es Fragment ist, handeln andere, umgebende Textpassagen davon, wie einige Kriminalisten versuchen, den Schluss des Dickens-Romans zu rekonstruieren bzw. überhaupt erst logisch zu erfinden (mag ja sein, dass Dickens den Schluss schon geplant hatte; er hat ihn aber nie aufgeschrieben bzw. veröffentlicht). Da unterhalten sich also einige Leute über den Dickens-Roman. Und dieses Rezept ließe sich doch beispielsweise auch auf den "Faust" übertragen. Nun ist der "Gag" von Fruttero und Lucenti, dass nämlich das Dickens-Fragment kriminalistisch, also selbst wieder spannend rekonstruiert wird, derart beim "Faust" (der ja vollständig ist) nicht wiederholbar. Auf den ersten Blick sieht es also so aus, als wenn das Gespräch über den "Faust" doch wieder nur ein arg pädagogisierender, nur besser versteckter Kommentar sein könnte. Genau dieser (manchmal in der heute leider fast vergessenen "sokratischen" Buchform der "Dialoge" auftauchende) pädagogisierende Ton (in Galileis "Dialogen" heißt der Gesprächspartner sogar "Simplicio"!) wäre unbedingt zu vermeiden. Dazu aber gäbe es nur zwei Möglichkeiten: entweder sind beide (oder mehr) Gesprächspartner gleich "schlau", oder die "dummen Fragen" des einen verunsichern auch den Schlaueren und führen ihn zu neuen Fragen und Antworten. Ich könnte mir solch ein Buch sogar als – nebenher - eine leise Satire auf die "Faustologie" der letzten 150 Jahre vorstellen. Wichtig wäre, dass die Menschen nicht nur redeten, sondern auch handelten. Vielleicht ließe sich ja doch eine fiktive, wenn nicht gar "faustische" Kriminalgeschichte drumherum bauen. Eine vielleicht spinnerte Idee: da finden zwei Leute auf einem Flohmarkt das völlig vergessene Buch "Faust" eines völlig vergessenen Autors namens Goethe und machen sich nun völlig unbelastet an dessen Entschlüsselung (incl.: "wer war dieser Goethe, wie ist das Buch entstanden?"). Also ein wenig so, wie Edgar Wibeau in "Die neuen Leiden des jungen W." Goethes "Die neuen Leiden des jungen Werther" liest. So fiktiv finde ich die Flohmarkt-Idee nebenbei gar nicht: vom "Faust", also dem angeblich "größten deutschen Drama", und Goethe, also dem angeblich "größten deutschen Dichter", hat zwar jeder gehört ("hat der nicht den Erlkönig geschrieben?"), aber ansonsten sind Goethe wie "Faust" doch weitgehend unbekannt und – auch durch Sekundärliteratur – verschüttet. Dreierlei dürfte ein populärwissenschaftliches Buch über den "Faust" allerdings nicht sein:
Das Buch sollte zudem zwar (soweit bei der Fülle der Sekundärliteratur zum "Faust" und mehr noch Goethe überhaupt noch halbwegs überschaubar) mit allen germanistischen Wassern auch der modernsten Forschung gewaschen sein; nur dürfte man es kaum merken
Ein unbedingt zu vermeidender Effekt wäre – zusammenhängend mit der billigen Biografistik – auch die Verwandlung des Objekts (Faust, Goethe) zur Mickey-Maus, wie sie etwa im "Amadeus"-Film vorgenommen wurde: die Rache der kleinen Geister am Genie. Die Alternative dazu muss ja keineswegs Anbetung sein. Das Buch über den "Faust" sollte nicht selbst "Literatur" sein wollen und schon gar nicht – vom Ton her – "goethisieren". | |
| PPS: | ||
| PPPS: | Eine "richtige" Wissenschaftssendung funktioniert heutzutage folgendermaßen:
|
Ausgesprochen lesenswert zum Thema: